Auf einem Markt mit Überschüssen gibt der billigste Anbieter den Preis vor. Das gilt auch für die Exportmärkte.
Wann immer Agrarpolitiker oder Agrarmanager Antworten auf verfahrene Preissituationen in der Landwirtschaft geben sollen, kommen mit Sicherheit Sätze wie: „Wir müssen den Exportanteil erhöhen“ oder „Wir müssen neue Exportmärkte erschließen“. Im Grunde geht es darum, ein Ventil für die heimischen Überschüsse irgendwo auf der Welt zu finden, um den Preisdruck von den Heimmärkten zu nehmen. Aber wenn alle das Selbe suchen, werden alle das Gleiche finden. Das drückt die Preise auch auf den Fremdmärkten. Nur wem es gelingt, sich zu unterscheiden, hat Erfolg. Exporte sind daher keine Wunderwaffe gegen den Preisverfall, wie das gerne dargestellt wird. Sie können nur die heimischen Märkte für eine gewisse Zeit entlasten, lösen aber nicht das grundsätzliche Problem einer Überproduktion.
Wer ein Massenprodukt in einen Massenmarkt irgendwo auf der Welt liefert, wird dafür auch nur den Preis für Massenware bekommen. Diese Märkte begünstigen die Billigstbieter und damit die Starken und die globalen Gunstlagen und verdrängen diejenigen mit kleinen Erzeugungseinheiten sowie jene, die unter schwierigen klimatischen, strukturellen oder topografischen Bedingungen erzeugen.
Die landwirtschaftlichen Exporte in den vergangenen Jahren sind stark gestiegen und haben durchaus auch Wertschöpfung ins Land gespült, aber am grundsätzlichen Gefüge der fehlenden Markenpolitik und der Überkapazitäten und des damit verbundenen Preisverfalles hat sich damit nichts verändert.
Für Massenware sind Exportmärkte keine Wunderwuzzis, die die Probleme, die man mit dem Produkt am Heimmarkt hat, lösen. Sie können kurzfristig Abhilfe schaffen, mildernd wirken und den Preis und das Preisumfeld eine Zeit lang stabilisieren. Die eigenen Hausaufgaben aber müssen erledigt werden. Darum kommt man nicht herum. Genau darin liegt auch eine der Hauptgefahrenquellen temporärer Überschussverwertung auf Exportmärkten. Sie mildern wie Schmerztabletten das brennende Problem und führen zu einem betäubenden Gewöhnungseffekt ohne tatsächlich etwas zur Ursachenbekämpfung beizutragen. Im Gegenteil, oft wird erst dadurch eine grundsätzliche Auseinandersetzung mit den bestehenden Marktgegebenheiten und eine Umorientierung mittels Innovation, Produktionsdrosselung oder Marketingmaßnahmen verhindert.
Es bildet sich eine Scheinfassade, die den realistischen Blick auf die Dinge ablenkt. Kurzfristige Exporterfolge befeuern nicht selten die Produktion und damit den langfristigen Preisverfall. Denn ein Gutteil der Beliebtheit von Exporten als Problemlöser ist der Tatsache geschuldet, dass damit alle aus dem Schneider sind. Die gesamte Branche braucht nicht mehr über neue Produktvarianten, Innovationen oder schmerzhafte Veränderungen nachzudenken. Motto: alles bestens erledigt.
Zu exportieren bedeutet, in einen globalen Markt mit weltweiter Konkurrenz zu Weltmarktpreisen zu liefern. Erfolgreich agiert man auch auf Exportmärkten nur, wenn man Erzeugnisse anbietet, die nicht alle anderen auch loswerden wollen. Wenn man das Besondere, das Einmalige anbieten kann (z.B. Zuchtvieh). Um das zu liefern, braucht es neues Denken, Visionen, Mut zu Neuem, neue Produkte und neue Strategien.
In überfüllten Märkten funktioniert die Zauberformel „Abrakadabra Export, wir zaubern alles fort“ leider nicht. Zumindest nicht zu vernünftigen Preisen.
Sie wollen uns Ihre Meinung zum Thema sagen? Schreiben Sie uns:
hans.meister@staging.landwirt-media.com, Tel.: 0316/821636-145, Fax: DW 151
Weitere Artikel aus
LANDWIRT AT 10/2016

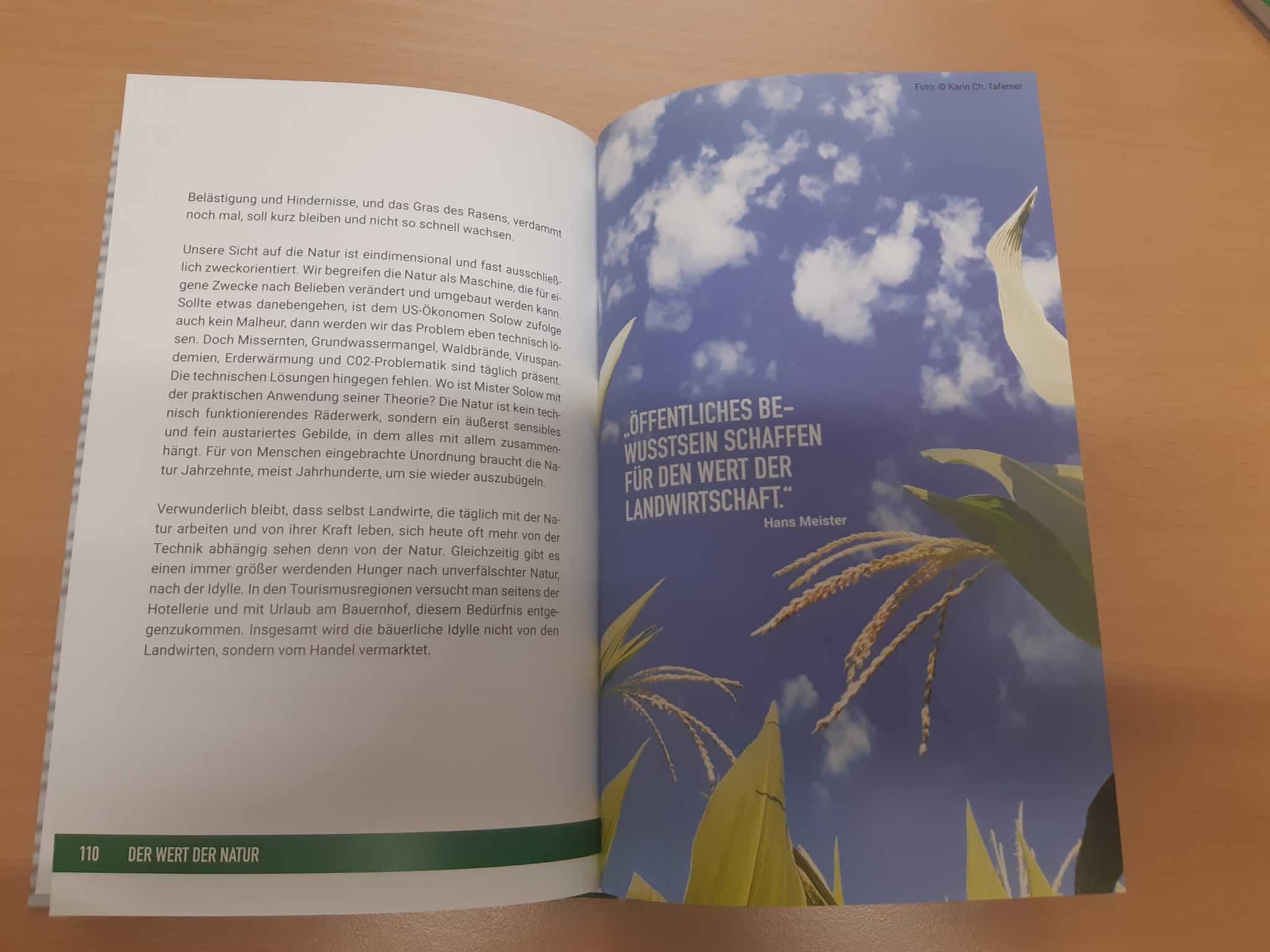

Kommentare